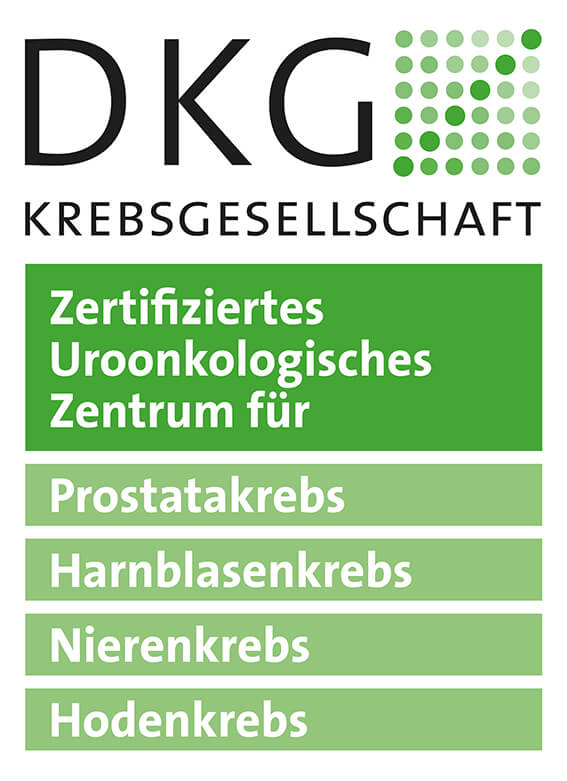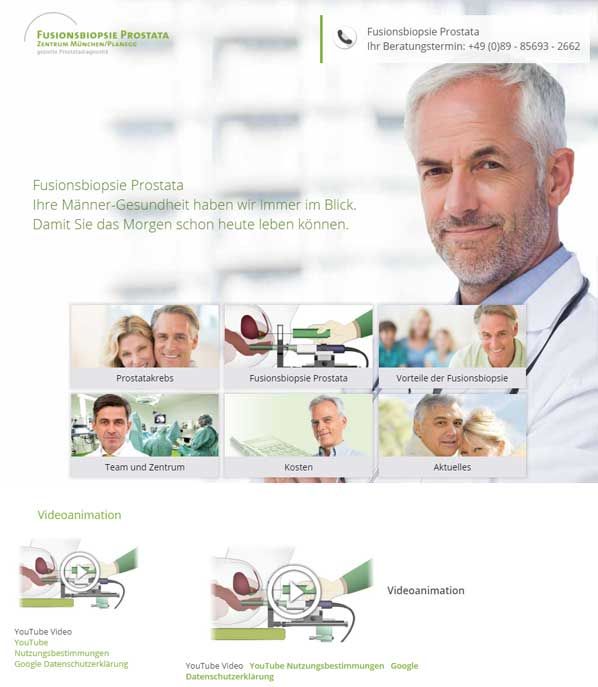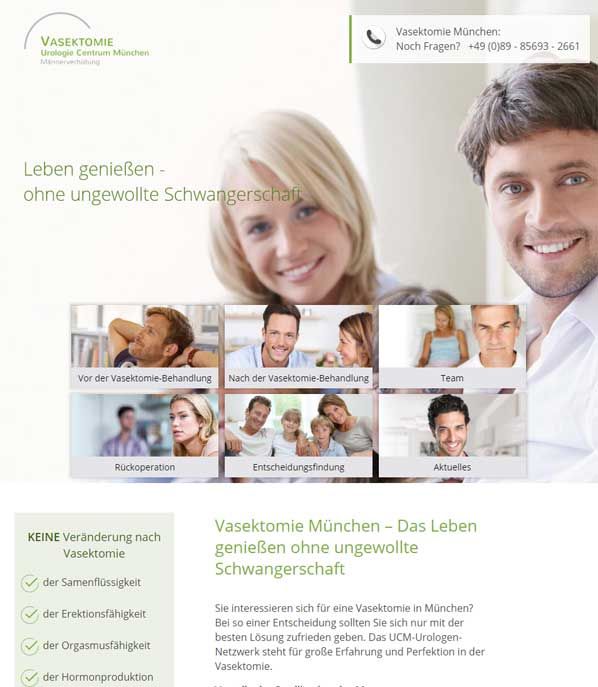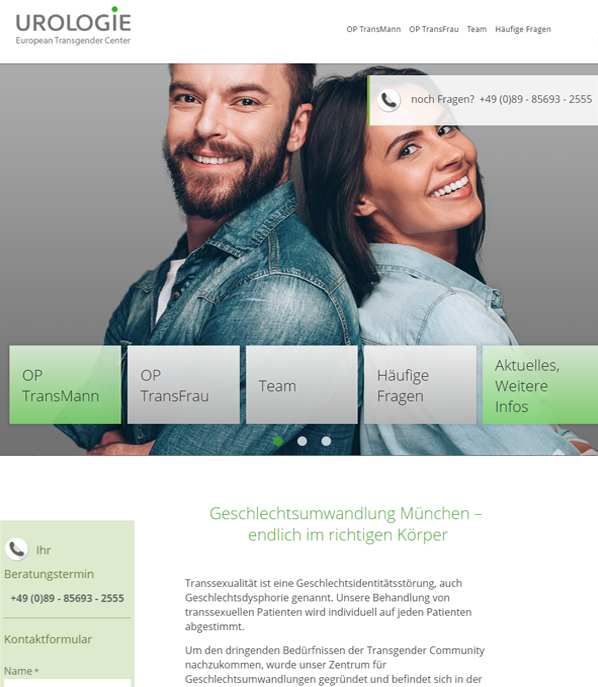„Testosterontherapie steigert nicht das Risiko für Prostatakrebs“
Die Ursachen eines Testosteronmangels sind vielfältig und die Symptome meist sehr unspezifisch. Beispielsweise kommt es im Alter physiologisch zu einem Absinken des Testosteronspiegels („Altershypogonadismus“). Betroffene Männer können unter Konzentrationsschwierigkeiten, Müdigkeit, Stimmungsschwankungen, Depressionen, Stoffwechselstörungen sowie Libidoverlust und Erektionsstörungen leiden. Diese Symptome führen bei einer Vielzahl der betroffenen Patienten zu einer signifikanten Verschlechterung der Lebensqualität. Symptomatische Patienten mit laborchemisch nachgewiesenem Hypogonadismus können daher unter Umständen von einer Testosteronsubstitutionstherapie profitieren.
Studien haben gezeigt, dass erniedrigte Testosteronwerte mit einer niedrigeren Inzidenz von Prostatakrebs assoziiert sind. Im Umkehrschluss wurde lange befürchtet eine Testosterontherapie könne das Risiko für die Entstehung von Prostatakrebs erhöhen. Bisher konnten Beobachtungsstudien hier keinen Zusammenhang zeigen, eine Testosterontherapie erhöht also nach aktuellem Kenntnisstand nicht das Risiko für Prostatakrebs.
Eine 2018 publizierte retrospektive Kohortenstudie mit hoher Fallzahl untersuchte einen möglichen Zusammenhang zwischen einer Testosteronsubstitutionstherapie und dem Auftreten von Prostatakrebs. Die Autoren werteten rückblickend Daten US amerikanischer Kriegsveteranen aus den Jahren 2002-2011 aus. Eingeschlossen wurden 147 593 Männer im Alter von 40-89 Jahren mit nachgewiesen erniedrigtem Testosteronspiegel. Hiervon erhielten 58 617 Individuen (etwa 40%) im Laufe des Studienzeitraumes eine Testosterontherapie (mittlerer Behandlungszeitraum 27.3 Monate). Männer mit erhöhtem Wert des Prostata-spezifischen Antigens (PSA), einer Prostatabiopsie, Prostata- oder Brustkrebs in der Vorgeschichte wurden ausgeschlossen.
Der Endpunkt der Studie war ein histologisch bestätigtes aggressives Prostatakarzinom (definiert als Gleason Score ≥ 8, initialer PSA ≥20ng/ml, Fernmetastasen), sowie jede Form des Prostatakarzinoms. Insgesamt wurden im Beobachtungszeitraum 313 aggressive Prostatakarzinome diagnostiziert. Hiervon entfielen 123 auf die Kohorte, die eine Testosterontherapie erhalten hatte und 190 auf die Gruppe der Männer ohne Testosterongabe. Dies entsprach einer in beiden Gruppen vergleichbaren Inzidenzrate ohne signifikante Risikoerhöhung für die Entwicklung eines Prostatakarzinoms nach Testosteronsubstitution. Auch nach Adjustierung auf verschiedene bekannte Störgrößen wie beispielsweise Begleiterkrankungen sowie Gewicht und Körpergröße blieben die Ergebnisse konsistent. Auch für den Prostatakrebs jedweden Schweregrades waren Inzidenzrate und Risiko in beiden Gruppen vergleichbar. Auch eine längere Therapiedauer sowie ein höheres Alter bei Testosterontherapiebeginn wirkten sich diesbezüglich nicht negativ aus.
Nichtsdestotrotz sollte laut EAU Leitlinie vor Beginn einer Testosterontherapie unter anderem ein Prostatakrebsscreening in Form einer rektalen Tastuntersuchung (DRU) sowie einer PSA Wert Bestimmung durchgeführt werden. Unter laufender Therapie sollten DRU und PSA Testung nach 3, 6 und 12 Monaten wiederholt werden, danach jährlich. Ein milder Anstieg des PSA Wertes in den ersten 12 Monaten ist dabei durch Studien gut belegt und zu erwarten, der Wert sollte aber nach dem ersten Jahr ein Plateau erreichen und nicht weiter ansteigen.
Insgesamt ist ein Fortführen der Testosterontherapie nur bei gutem Therapieansprechen und entsprechender Symptomlinderung sinnvoll. Insbesondere zu Beginn empfiehlt sich eine Applikationsform, die bei Auftreten unerwünschter Wirkungen ein rasches Absetzen erlaubt, beispielsweise Testosteron in Gelform zum täglichen Auftragen auf die Haut.
Die Sicherheit einer Testosterontherapie bei Patienten mit lokal begrenztem, nicht metastasiertem Prostatakrebs in der Vorgeschichte bleibt jedoch weiterhin viel diskutiert. Aktuell empfehlen die EAU Leitlinien eine Limitation der Testosterontherapie auf diejenigen Patienten, die folgende Kriterien erfüllen: initial lokal begrenzter Prostatakrebs, Gleason Score <8, initialer PSA Wert <10ng/ml, chirurgische Therapie mindestens ein Jahr zurückliegend mit seither unauffälligen Nachsorgeuntersuchungen und aktueller PSA Wert unter der Nachweisgrenze. Um die Langzeitsicherheit einer Testosteronbehandlung bei dieser Patientengruppe zu dokumentieren wären randomisierte und Placebo kontrollierte Studien mit langem Nachbeobachtungszeitraum erforderlich.
Zu den absoluten Kontraindikationen, die die Testosterontherapie auch bei symptomatischen Patienten als Therapieoption ausschließen, zählen weiterhin der lokal fortgeschrittene und metastasierte Prostatakrebs, männlicher Brustkrebs, schwere Herzinsuffizienz sowie ein aktiver Kinderwunsch. In diesen Fällen müssen individuell alternative Möglichkeiten zur Symptomlinderung mit dem behandelnden Arzt diskutiert werden.
Quellen:
- Dohle GR, Arver S, Bettocchi C, et al. Guidelines on male hypogonadism. European Association of Urology (EAU), updated and presented at EAU Annual Congress 2018.
- Walsh TJ, Shores MM, Krakauer CA, Forsberg CW, Fox AE, Moore KP, et al. (2018) Testosterone treatment and the risk of aggressive prostate cancer in men with low testosterone levels. PLoS ONE 13(6): e0199194. https://doi.org/ 10.1371/journal.pone.0199194