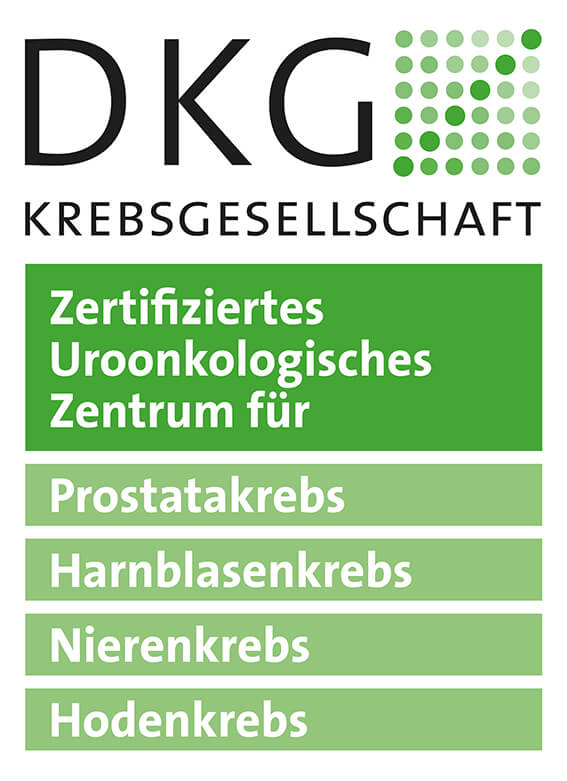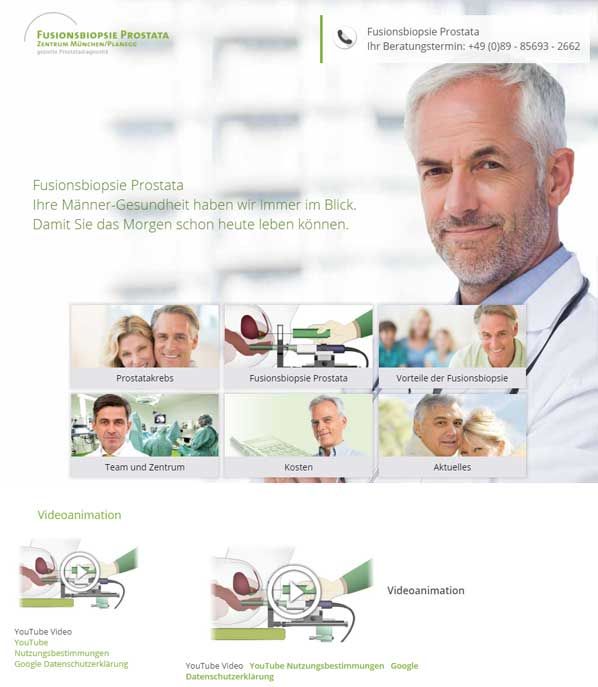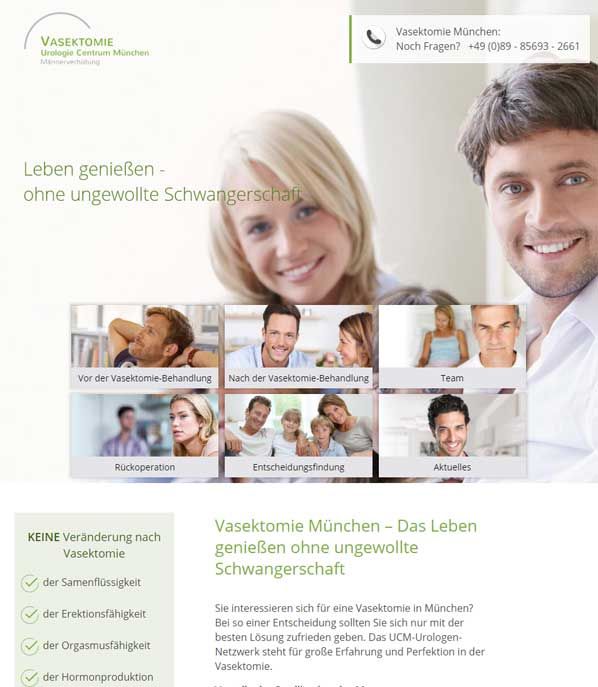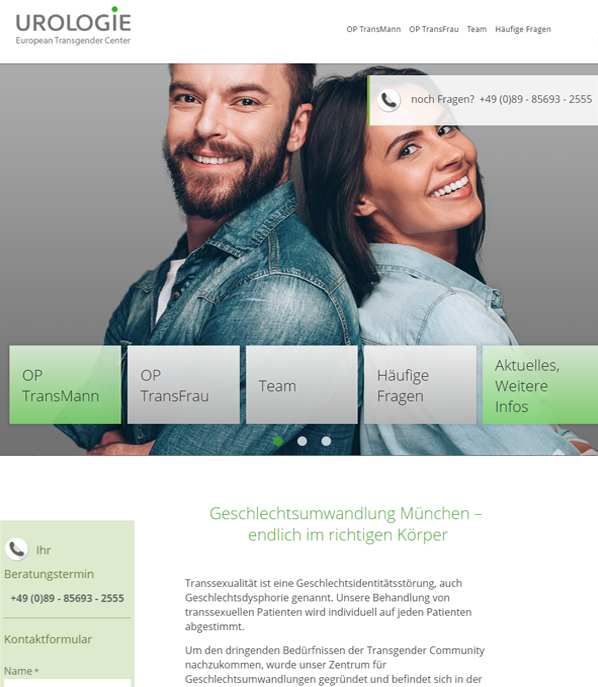Urologische Erkrankungen in der Schwangerschaft
Während der Schwangerschaft können an urologischen Erkrankungen die
- asymptomatische Bakteriurie (ASB),
- die akute Zystitis, Pyelonephritis oder
- Urolithiasis
Asypmtomatische Bakteriurie

Bei der asymptomatische Bakteriurie besteht an sich keine Gefahr für Mutter und Kind oder das Risiko einer Frühgeburtlichkeit. Allerdings kann dadurch unbehandelt in 30-50% der Fälle eine akute Zystitis und in 25% der Fälle eine Pyelonephritis entstehen.
Die Diagnose der ASB erfolgt mittels Urinsediment und Streifentest. Falls sich hieraus der Verdacht auf eine Bakteriurie ergibt wird eine Urinkultur angelegt.
Als weitere diagnostische Maßnahme kann nach Ermessen des bandelnden Arztes eine Sonographie zum Ausschluss einer Dilatation der oberen Harnwege oder Restharnbildung durchgeführt werden.
Ergibt sich in der Urinkultur ein Keimnachweis, sollte diese wiederholt werden, um unnötige Antibiotikagaben zu vermeiden.
Bei der Therapie der ASB kann zwischen Niedrig-Risiko-Patientinen (Einlingsgravidität ohne Risikofaktoren, kein Gestationsdiabetes, keine vorausgegangene späte Fehlgeburt oder Frühgeburt) und Risiko-Patientinnen (Z.n. später Frühgeburt/ Fehlgeburt/ Pyelonephritis) unterschieden werden.
Es wird prinzipiell die antibiotische Therapie der ASB in der Schwangerschaft empfohlen, allerdings ist dies lt. einiger Autoren für die Gruppe der Niedrig-Risiko-Patientinnen nicht zwingend indiziert und sollte individuell abgewägt werden.
Die ASB wird antibiotisch mittels Penicilline, Cephalosporine oder Fosfomycin behandelt.
Akute Zystitis/ Pyelonephritis
Kommt es während der Schwangerschaft zu einer akuten Zystitis oder Pyelonephritis (jeweils 1-2% der Patientinnen) kann es zu Folgeschäden für Mutter und Kind kommen (Fehlgeburt, Frühgeburt, niedriges Geburtsgewicht, Präeklampsie, intrauteriner Fruchttod).
Deshalb muss noch vor Erhalt der Urinkultur und des Antibiograms die antibiotische Therapie eingeleitet werden.
Im Falle einer Zystitis sollte ein Cephalosporin (Gruppe 2 und 3) oder Fosfomycin gegeben werden.
Mit Erhalt des mikrobiologischen Befundes kann die Antibiose ggf. testgerecht umgestellt werden.
Bei V.a. Pyelonephritis einer schwangeren Patientin wird die stationäre Aufnahme und Beginn einer i.v.-Antibiose empfohlen. Das Antibiotikum der Wahl ist in diesem Fall ein Cephalosporin (Gruppe 2 und 3).
Desweiteren solllte eine adäquate Schmerz- und Infusionstherapie eingeleitet werden.
Eine sonographische Kontrolle der Nieren und der Blase, sowie die regelmäßige Kontrolle der Laborparameter sind zudem notwendig.
Mit Besserung der Symptomatik und bei normalisierten Infektparametern kann die Antibiose (wenn möglich) testgerecht oralisiert werden.
Falls die Patientin ein septisches Krankheitsbild bietet, sollte sie zudem intensivmedizinisch mitbetreut werden.
Bei drohender Frühgeburt ist die Lungenreifeinduktion mit Celestan indiziert.
Fazit:
Antibiotische Therapie während der Schwangeschaft:
Penicilline, Cephalosporine, Fosfomycin
- längere und höhere Therapiedosis nötig wegen Erhöhung des Verteilungsvolumens in der Schwangerschaft
- Angst vor schädlicher Wirkung ist unbegründet
- bei Unklarheiten diesbezüglich www.embryotox.de
- auf Dosisreduktion oder Verkürzung der Therapiedauer sollte verzichtet werden
Urolithiasis
Nichtschwangere und schwangere Patientinnen haben ein gleich hohes Risiko für eine Urolithiasis.
Diagnostisch sind die Urin- und Ultraschalluntersuchung durchzuführen. Röntgenuntersuchungen, wie üblicherweise bei Patienten mit Steinleiden durchgeführt, sind während der Schwangerschaft kontraindiziert!
Durch die physiologische Dilatation der Harnwege während der Schwangerschaft kommt es in ca. 80% der Fälle zum spontanen Steinabgang.
Somit wird primär die konservative Therapie mittels Schmerzmittel (z.B. Paracetamol) und Spasmolytika (z.B. Butylscopolamin) empfohlen.
Bei Komplikationen wie z.B. Infektion, vorzeitige Wehen oder therapierefraktäre Koliken muss ggf. eine DJ-Anlage durchgeführt werden.
Die definitive Steintherapie erfolgt im Verlauf post partum.
Allerdings ist in Ausnahmefällen und bei strenger Indikationsstellung - noch vor der Geburt des Kindes - eine Steinsanierung mittels Ureterorenoskopie vertretbar. Dieser operative Eingriff sollte dann unbedingt interdisziplinär, in Zusammenarbeit mit Gynäkologen und Neonatologen, erfolgen.
Literatur
Kentner A, Naumann G. Urologische Erkrankungen in der Schwangerschaft. Empfehlungen zur Diagnose und Therapie. URO-NEWS 2017; 21(6)
AWMF-Leitlinie 043/044 (Aktualisierung 04/2017)
AWMF-Leitlinie 043/025