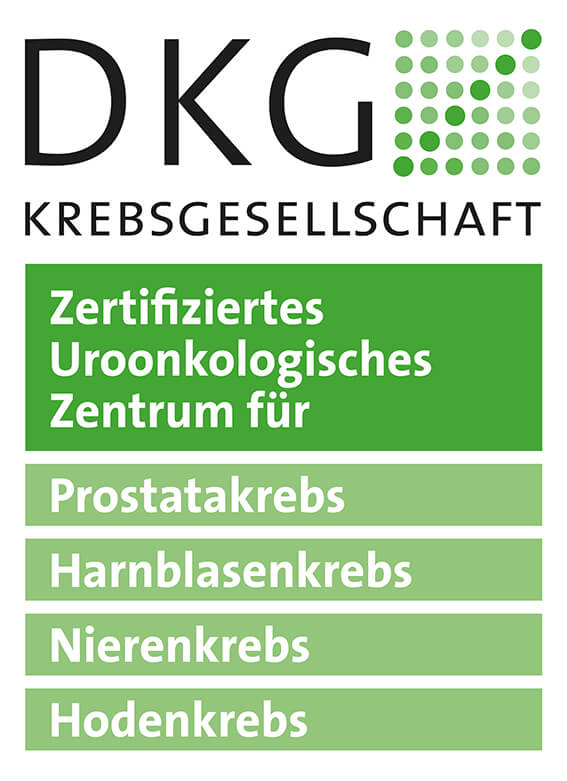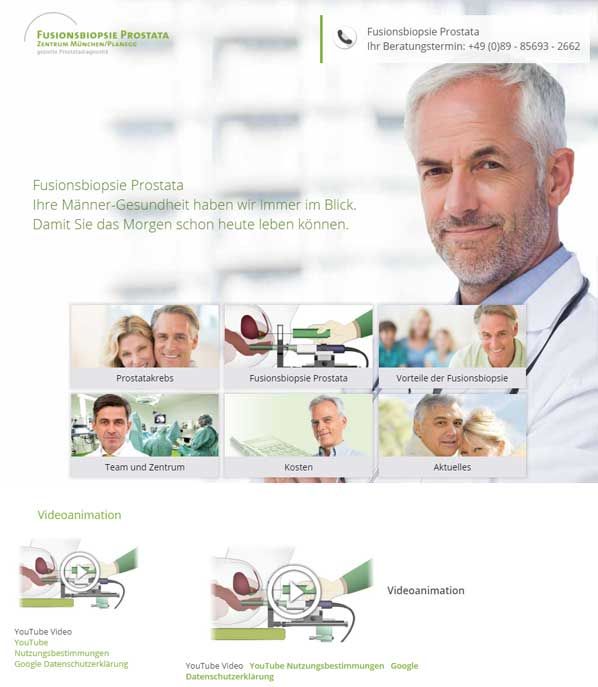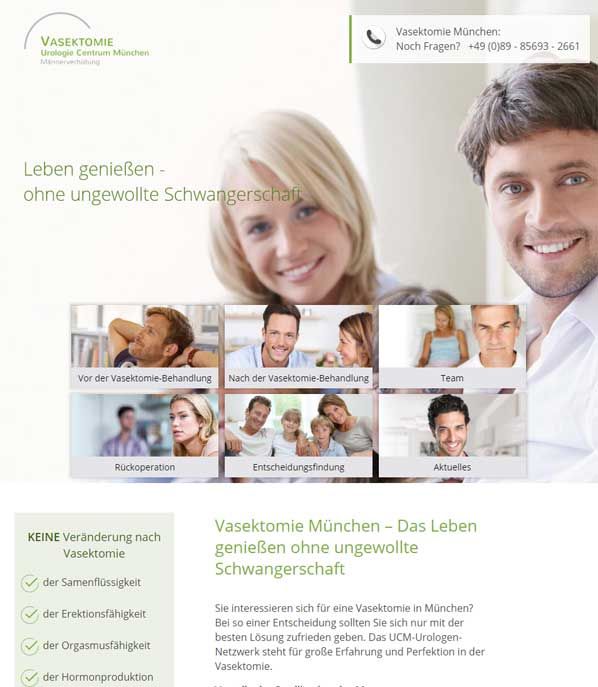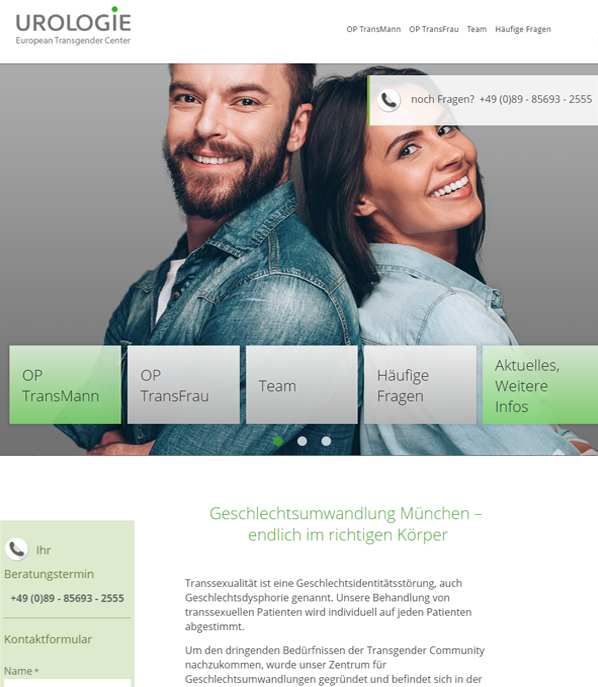Für die Penoidbildung wird ein relativ großes Stück Haut mit Unterhautfettgewebe benötigt, das durch ein Blutgefäß ernährt wird und möglichst einen sensiblen Hautnerven beinhaltet. Die häufigsten Entnahmestellen bzw. Gewebequellen für die Bildung eines Penoids ist der Unterarm (Radialislappenplastik, engl.: radial forearm free flap, kurz RFFF), der Oberschenkel (ALT-Lappen, engl.: anterolateral thigh flap), die Leistenregion bzw. Flanke (Leistenlappen, SCIP-Lappen, engl.: superficial illiac artery perforator flap) oder der Rücken (Latissimus dorsi-Lappen, engl.: latissimus dorsi flap).
Bei der Radialislappenplastik wird aus der Haut an der Innenseite des Unterarms die Harnröhre geformt – ebenso ggf. auch bei der ALT-Lappenplastik vom Oberschenkel. Übermäßige Behaarung in diesem Gebiet kann Komplikationen bei der späteren Harnröhre hervorrufen (z.B. Steinbildung, Trichobezoare, Harnwegsinfekte). Das betreffende Areal kann bzw. sollte vor dem Penoidaufbau permanent enthaart werden. Eine Kostenübernahmezusage dafür kann im Vorlauf von der Krankenkasse durch Vorlage unseres Sprechstundeberichts eingeholt werden.
Narben verbleiben an der Entnahmestelle des Lappens für das Penoid und an der Stelle, an der das Hauttransplantat zur Deckung der Lappen-Entnahmestelle entnommen wird (in der Regel Unterbauch oder Leiste(n)). Narben entstehen auch an der „unteren“ Seite des Penoids und zirkulär an dessen Basis.
Bisher gab es in unseren Nachuntersuchungen nach Abheilung des Unterarms keine wesentlichen Einschränkungen. Prinzipiell können aber unter anderem Bewegungs- und Gefühlsstörungen, Kraftminderung sowie gesteigertes Kälteempfinden resultieren. Um das Risiko insbesondere für Bewegungsstörungen zu minimieren, sind zur Nachbehandlung Eigenübungen und Krankengymnastik nötig. Zur Reduktion der Narbenbildung am Unterarm wird postoperativ eine Kompressionsbandage (meist mit Silikonfolieneinlage) rezeptiert.
Ja, wenn eine Harnröhre (Neourethra) konstruiert wurde, ist Wasserlassen im Stehen in der Regel möglich. Bei einfacheren Verfahren ohne Harnröhrenverlängerung bleibt das Urinieren im Sitzen erforderlich.
Die Klitoris wird bei der Penoidbildung erhalten und in das neu gebildete Penoid integriert. Zudem werden Nerven aus dem Gewebelappen mit Leistennerven oder Klitorisnerven mikrochirurgisch verbunden. Dadurch können Berührungssensibilität und erogene Empfindungen häufig erhalten oder neu aufgebaut werden.